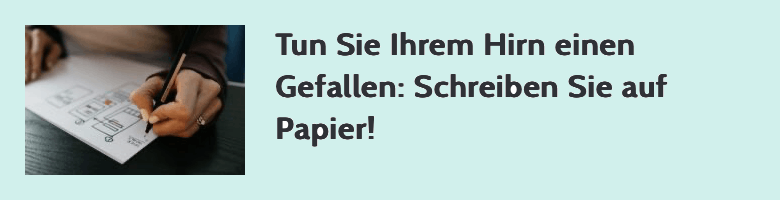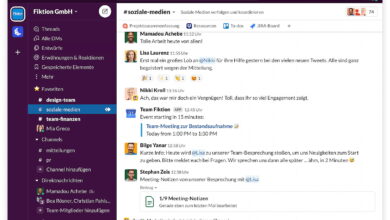Der digitale Alpha-Arbeiter: Wenn Klischees zu Soft Skills werden
Digitalisierung scheint ohne flexible, zur Kultur passende, T-Shirt tragende, gut gelaunte Team-Player mit der Freude an Etappenzielen unmöglich. Doch wer sagt, dass Anzug-Individualisten, versunken in Arbeit am Schreibtisch ihres Einzelbüros den digitalen Wandel nicht ebenso mittragen können?
Wer in der modernen Arbeitswelt bestehen will, muss neben digitaler Kompetenz und technologischem Verständnis auch besondere Soft Skills mitbringen. Manche Qualifikation kann man erwerben, andere sind nicht einmal überzeugend vorzuspielen – und wenn doch, geht’s auf Gemüt. Der perfekte digitale Arbeitnehmer ist ein einziges Klischee, doch seine „Voraussetzungen“ werden heruntergebetet wie die Zehn Gebote. Wir kommen auf sechs, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Du sollst ein Teamplayer sein
Jetzt, da Collaboration-Tools zu jeder guten Büroausstattung gehören, muss man sie auch nutzen. Aufgaben werden in Teams gestemmt, die sich via Videokonferenz und Livechat über alle Grenzen und Zeitzonen hinweg gegenseitig dauernd inspirieren. Ohne die Fähigkeit zur Gruppenarbeit fehlt dem Arbeitnehmer ein bedeutender Soft Skill im digitalen Zeitalter.
Da geht es nicht immer harmonisch zu. Die einen reißen ein Meeting direkt an sich. Manche sagen zu allem Ja und Amen, nur um beim Feierabend-Bier dann doch über die Ergebnisse zu lästern. Andere sind immer dagegen, wollen sich nur profilieren oder haben eigentlich zum bevorstehenden Meeting-Thema bestenfalls nichts zu sagen, im schlechtesten Fall keine Ahnung.
Es soll Leute geben, die sich für Teamwork nicht oder nicht ausnahmslos erwärmen können. Falsch wäre aber, sie als Eigenbrötler, Faulenzer oder ewiger Kritiker einzustufen. Sie fühlen sich eben im Eins-zu-Eins-Gespräch wohler, sind introvertiert und eher schüchtern, lesen lieber das Meeting-Protokoll und schalten sich später ein. Oder sie nehmen dankend die Zuteilung konkreter Aufgaben an. Nichts spricht dagegen, dass sie trotzdem Kollegen unterstützen, wenn sie darum gebeten werden und auch mal mit einer innovativen Idee um die Ecke kommen.
Du sollst das Homeoffice ehren
Individualisten sind möglicherweise diejenigen, die sich im Homeoffice wohlfühlen. Möglich ist es ja in vielen Fällen, von daheim zu arbeiten. Laptop, Smartphone, Schreibtisch und Internet (Cloud) – die Arbeitsutensilien sind alle da und es gibt etliche Gründe, die mobile Arbeitswelt gut zu finden. Wer dennoch ins Büro dackelt, ist für manchen Arbeitgeber ein allzu traditioneller Arbeitnehmer, der partout nicht die Vorzüge der modernen Arbeitswelt genießen will.
Wer das Homeoffice nicht mag, wird als rückständiger Traditionalist abgestempelt.
Dabei ist Homeoffice gar nicht so leicht. Am heimischen Schreibtisch kämpft man gegen den Kühlschrank oder gegen unsinnige, aber süchtig machende YouTube-Videos an. Das bedeutet: Struktur und eine stringente To-Do-Liste sind eigentlich Pflicht. Schließlich schaut einem niemand über die Schulter. Wer trotz der propagierten Freiheit lieber in die Firma fährt, ist nicht unzeitgemäß, sondern sich sogar seiner vielleicht chaotischen Arbeitsweise bewusst. Auch ist nicht rückständig, wer gern den „Flurfunk“, das Stimmungsbarometer einer Firma, regelmäßig mitbekommen mag und auch nicht, wer dazu neigt, bei häufigen Homeoffice-Tagen den Kontakt zu den Team-Kollegen zu verlieren.
Du sollst zur Unternehmenskultur passen
Teams und Homeoffice zählen zum neuen guten Ton bei der Unternehmenskultur. Letztens wusste noch kaum jemand, was das ist. Irgend etwas zwischen Büroräumen, Kantine und Parkplatz vermittelte ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Beides hat mit der Firmenkultur zu tun – allein man nannte es nicht so. Mit dem Aufkommen der Digitalisierung stehen Werte im Raum, die bewusst zu Kulturvoraussetzungen stilisiert werden. Dazu zählen Wertschätzung und Diversität. Letztere zeichnet sich dadurch aus, dass das Kollegium weiblich, männlich, europäisch, asiatisch, homosexuell, heterosexuell, introvertiert, extrovertiert oder sonst wie vielfältig ist. Sie belebe die Firmenkultur und mache eine Belegschaft kreativer, auch so eine Eigenschaft im digitale Zeitalter, heißt es. Wie aber soll jemand zur Kultur passen, wie soll man jemanden gut finden, der so ganz anders ist?
Wie soll jemand zur Kultur passen, der so ganz anders ist?
Wenn Unternehmenskulturschaffende Diversität nicht explizit zum Kulturgut erhoben haben bekommen sie jetzt Stress. „Zur Kultur passend ist gegeben, wenn sich die Mitarbeiter im Gespräch mit der Person wohlfühlen. Das heißt, sie bevorzugen jemandem, der so ist wie sie selbst“, kritisiert Scott Belsky, Chief Product Officer bei Adobe. Das widerspreche der Diversität. Statt eine Blaupause anderer Mitarbeiter auf neue Kollegen zu legen rät Belsky dazu, Bewerber danach zu beurteilen, ob sie einen neugierig machen bei dem was sie tun. Ob man sie vor dem geistigen Auge auf der After-Work-Party stehen sieht, ist dabei erst einmal zweitrangig.
Du sollst immer happy und zufrieden sein
Keine After-Work-Party, also ist der Kollege eine Spaßbremse und fühlt sich im Unternehmen nicht wohl, so eine gängige Argumentationskette. Ohne Dauergrinsen im Gesicht ist man kein akzeptiertes Mitglied der digitalen Arbeitsgesellschaft. Schließlich geben sich Unternehmen alle Mühe, einem die Arbeit zu versüßen. Kaum ein Arbeitgeber lässt Gelegenheiten zum Feiern in der eigenen Büro-Bar aus. Überhaupt hübscht er das Büro auf, verfügt über topmoderne Konferenzräume und stellt jedem Mitarbeiter den angesagtesten Technik-Schnickschnack zur Verfügung. Mit dem Streben nach Work-Life-Balance nimmt man das an und hat demzufolge absolut keinen Grund, schlecht gelaunt zu sein. Ist ja auch gut für das Betriebsklima, zudem kann ein Team nur dann ganze Arbeit leisten, wenn alle happy sind.
Und wenn man doch mal mit dem falschen Fuß aufgestanden ist? Kann man nicht auch mit einem dicken Hals einen guten Job machen? Viele Studien sprechen dagegen. Wer fröhlich ist, ist produktiver, lautet oft das Fazit. Trotzdem: Ein Kriterium in Zeiten digitaler Wohlfühlgesellschaft, in der smarte Automationslösungen den Beschäftigten nervige Arbeit abnehmen, damit ihnen mehr Zeit für Strategie und Innovation bleibt, ist es nicht. Im Gegenteil, wer Happyness vortäusch, macht wahrscheinlich einen noch schlechteren Job. Außerdem fällt das meistens auf und dann steht ein als Feelgood-Manager getarnter Personaler neben einem und fragt fürsorglich: „Kann ich Dir was Gutes tun?“. Ganz dünnes Eis.
Du sollst Dir kleine Ziele setzen
Es heißt „Digitale Transformation“. Der Wandel kommt deshalb nicht über Nacht, sondern Stück für Stück. Weil das Ziel, ein digitalisiertes Unternehmen, aufgebaut auf Produktivität und Effizienz durch Datenanalyse, KI und glückliche Mitarbeiter, ein ordentliches Stück Weg ist, soll jeder zwischendurch innehalten, mit Stolz zurückblicken und jedes noch so kleine Etappenziel feiern.
Zu leicht erreichbare Ziele sind langweilig.
Dass es nicht immer gut ist, sich für ein schnelles Erfolgserlebnis wenig ambitionierte Ziele zu setzen, belegt eine neue Studie. Ihr Fazit: Mitarbeiter mit schwierigeren Aufgaben sind motivierter und besonders stolz, wenn sie dieses Ziel erreicht haben, als diejenigen, die sich über Kleckerkram freuen sollen, ohne den Kontext des großen Ganzen zu überreißen. Dabei geht es nicht darum, durchzuarbeiten bis das Projekt abgeschlossen ist. Zu kurz gesteckte Ziele stimmen den Arbeitnehmer eher pessimistisch, weil der zu viel Zeit hat darüber nachzudenken, was alles schief gehen kann. Die Wissenschaftler, die einigen Probanden komplexere Ziele setzten, erkannten, dass diese sich in ihre Arbeit mehr hineinfuchsten und optimistischer waren, das Projekt erfolgreich abzuschließen.
Du sollst ein weißes T-Shirt tragen
Bilder von Coworking-Spaces oder modernen Büroumgebungen zeigen zumeist hippe jungen Menschen in lässiger Kleidung. Programmierer sind besonders oft in weißen T-Shirts zu sehen, wie sie vor Scrum-Boards stehen und total agil an der Entwicklung eines Produkts feilen. Konservativ gekleidete Menschen kommen auf diesen Bildern nicht vor, ergo: Wer kein T-Shirt trägt, ist nicht modern und passt nicht zu Unternehmen mit Teamwork, Flexibilität und moderner Unternehmenskultur.
Auf derart lustige Korrelationen hat der ehemalige Mathematik-Professor und Ex-Chef-Technologe bei IBM, Gunter Dueck, auf dem Digital Workplace Summit hingewiesen. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Zeit von Korrelationen vorbei ist und hat ein Beispiel parat: Immer, wenn es regnet, spannt man einen Regenschirm auf. Die absurde Korrelation wäre ja, dass Leute in trockenen Gegenden Regenschirme aufspannen in der Annahme, dass es dann regnet.
Das einzige Gebot, das zählt: Du sollst Du selbst sein (dürfen)
Die digitale Transformation formt nicht die Menschen. Die Menschen formen die digitale Transformation. Kann jeder (mit dem nötigen Respekt und Anstand versteht sich) so handeln und arbeiten, wie es seiner Arbeitsweise entspricht, ist er am ehesten motiviert, produktiv und bereit für Neues.
Die digitale Transformation formt nicht die Menschen. Die Menschen formen die digitale Transformation.
Natürlich ist es toll, wenn sich unterschiedliche Menschen gut verstehen und es gibt Studien, wonach diverse Teams sowohl den Umsatz als auch die Erschließung neuer Geschäftsmodelle ankurbeln können. Dennoch darf man Diversität etwa nicht erzwingen, das sieht nach Quote aus und ist kontraproduktiv, wenn sich Mitarbeiter im Sinne des Teams verbiegen müssten. Es ist auch prima, wenn Unternehmen Homeoffice-Regelungen erlauben, die dank digitaler Tools erst möglich werden und manchen Mitarbeiter zu einem produktiveren Arbeitstag verhelfen. Und welcher Arbeitgeber findet es nicht gut, wenn bestens gelaunte Beschäftigte in den Fluren lachen? Das alles ist aber kein Maßstab für den perfekten digitalen Arbeiter, sondern bedient nur Klischees, denen nachzueifern manchen die Digitalisierung eher verleidet.