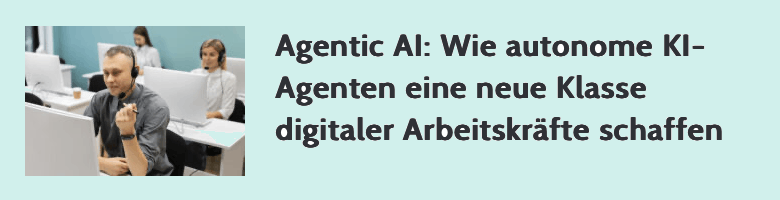Schieben Sie die KI-Fortbildung lieber nicht auf die lange Bank
KI-Fortbildung ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Ohne eine kompetente Belegschaft wird das Werkzeug, das Produktivitätssprünge verspricht, wirkungslos bleiben.
Wahrscheinlich können Sie es nicht mehr hören. Sprüche wie „KI wird die Arbeitswelt radikal verändern“ oder „Wir müssen die Mitarbeiter auf die KI-Reise mitnehmen“ sind mittlerweile so abgedroschen, dass sie einen nicht einmal mehr langweilen. Doch am Wahrheitsgehalt und der Relevanz dieser Aussagen hat sich nichts geändert – im Gegenteil. Die Notwendigkeit, die Arbeitenden für den Umgang mit KI-Tools fortzubilden, ist zwingend wie nie. Sogar das Bundesarbeitsministerium hat im Rahmen seines Auftrags, Arbeitsplätze zu sichern und die deutsche Industrie wettbewerbsfähig zu halten, die KI-Fortbildung weit oben auf seiner Agenda gesetzt.
KI schafft für die Arbeitenden Freiräume für kreative und höherwertige Tätigkeiten.
Hinzu kommt, dass Unternehmen durch das KI-Gesetz der EU (AI Act) dazu verpflichtet sind, ihre Belegschaft für KI zu schulen. „Artikel 4 verlangt von Anbietern und Betreibern von KI, nach besten Kräften Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Mitarbeitende und externe Beteiligte über ein angemessenes Maß an KI-Kompetenz verfügen – angepasst an Rolle, Vorwissen und Nutzungskontext“, erklärt Anja Miller, Senior Digital Designerin und KI-Expertin beim IT-Beratungsunternehmen MaibornWolff (siehe Interview weiter unten).
KI-Fortbildung steht ganz am Anfang
Laut einer im Juli 2025 veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom war bis dahin ein Fünftel (20 Prozent) der Berufstätigen von ihrem Arbeitgeber im KI-Einsatz geschult. Für weitere 6 Prozent waren entsprechende Fortbildungen zumindest vorgesehen. Der großen Mehrheit von 70 Prozent der Beschäftigten wird allerdings keine KI-Fortbildungen angeboten.
„Angesichts des Tempos, mit dem sich KI-Technologien in allen Branchen integrieren, ist das eindeutig zu wenig“, findet Robert Rosellen, VP Sales & Country Manager Germany bei ServiceNow. Dies sei bedauerlich, da KI das Potenzial habe, existierende Jobprofile aufzuwerten. „KI schafft Freiräume für kreative und strategische Tätigkeiten. Unternehmen können so nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch neue Geschäftsmodelle entwickeln. Wer heute in KI-Kompetenz investiert, erfüllt damit nicht nur regulatorische Anforderungen. Er legt auch den Grundstein für Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Akzeptanz im Unternehmen – und befähigt Menschen, den technologischen Wandel aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten.“
KI-Einführung ist kein Nullsummenspiel
Beim Angehen dieser Aufgabe ist es wichtig zu verstehen, dass es bei der KI-Fortbildung nicht nur um das Training an einem neuartigen Tool geht, sondern auch um eine Neudefinition der Tätigkeit jedes betroffenen Mitarbeiters. Denn vieles spricht dafür, dass die Einführung von KI ähnliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben wird wie die Einführung von PCs in den Verwaltungen der Unternehmen in den Achtzigerjahren. Damals wurde die Arbeit mit Daten und Informationen auf eine neue Basis gestellt – digitale Dateien und Datenbanken statt Akten als Speicherorte für Informationen und Software statt Papier als Arbeitsmittel. Die Umstellung hat damals viele Tätigkeiten obsolet gemacht, die verbliebenen Tätigkeiten neu definiert und zusätzlich Jobprofile geschaffen, die es bis dahin nicht gab.
„Die Teams müssen sich ihre Prozesse ansehen und herausfinden, wie KI sie ergänzen kann.“
Genau aus diesem Grund warnte Dave Wright, Chief Innovation Officer bei ServiceNow, vor einiger Zeit an dieser Stelle davor, KI als Nullsummenspiel zu betrachten, bei dem es nur darum geht, die Effizienz zu steigern und Personalkosten zu sparen. Das Gegenteil sei der Fall: „Eine Belegschaft, die über das Wissen und die Fähigkeiten verfügt, die neuesten Technologien zu nutzen, ermöglicht es Unternehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber dazu muss das gesamte Unternehmen proaktiv handeln. Die Führungskräfte müssen entscheiden, wie KI von den Mitarbeitern genutzt werden soll. Die Teams müssen sich ihre Prozesse ansehen und herausfinden, wie KI sie ergänzen kann. Und schließlich sollten die Mitarbeiter darüber nachdenken, wie KI ihnen helfen könnte, ihre Arbeit besser zu erledigen.“
Know-how sichert Wettbewerbsvorteile
Unternehmen, die sich die Vorteile dieser Technologie zügig zu Nutze machen, haben außerdem die Chance, Wettbewerbsvorteile zu erzielen – zumindest für eine kurze Zeit. Denn da sich neue digitale Technologien erfahrungsgemäß sehr schnell verbreiten, gleicht sich über kurz oder lang die Ausgangsposition der Unternehmen im Wettbewerb wieder aus. Die Nutzung dieses Zeitfensters setzt jedoch die Verfügbarkeit des dazugehörigen Know-hows voraus sowie die internen Prozesse, dieses Know-how ins Spiel zu bringen – also jener Fähigkeiten, die digitale Vorreiter kennzeichnen. Letztere können technologische Neuerungen schneller anwenden als die Konkurrenz und die kurzzeitige technische Überlegenheit nutzen, um ihre Marktposition zu verbessern. Der langfristige Vorteil der schnellen Implementation technischer Neuerungen: Wenn sich die Ausgangsposition im Wettbewerbsfeld wieder nivelliert hat, bleibt als differenzierender Faktor die menschliche Arbeit – und eine gut ausgebildete Belegschaft kann hier einen entscheidenden Unterschied ausmachen.
Robert Rosellen von ServiceNow hat vier konkrete Handlungsanweisungen, die Unternehmen bei der KI-Weiterbildung beherzigen sollten:
- Bedarfe analysieren: Ermitteln Sie, welche Kompetenzen Ihre Teams für den sicheren und effektiven KI-Einsatz benötigen – abhängig von den eingesetzten Anwendungen und deren Risiken.
- Strukturierte Lernangebote schaffen: Entwickeln oder wählen Sie praxisorientierte Trainingsformate, die Grundlagenwissen ebenso vermitteln wie anwendungsnahe Szenarien.
- Verantwortungskultur fördern: Sensibilisieren Sie Teams für ethische Fragestellungen, potenzielle Verzerrungen und die kritische Bewertung von KI-Ergebnissen.
- Lernangebote zugänglich machen: Schaffen Sie eine offene Lernkultur und sorgen Sie dafür, dass Weiterbildung allen Beschäftigten niedrigschwellig zur Verfügung steht.
„Trainingsangebote differenziert nach Zielgruppen gestalten“
Interview mit Anja Miller, Senior Digital Designerin und KI-Expertin bei MaibornWolff

Welche Wege stehen Unternehmen offen, um KI-Kompetenz intern aufzubauen?
Für den Kompetenzaufbau sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt – entscheidend ist, dass die Maßnahmen wirksam sind. Der Gesetzgeber verzichtet bewusst auf starre Vorgaben zu Schulungsinhalten oder verpflichtenden Zertifikaten. Gefordert ist ein flexibler, risikobasierter Ansatz, der sich an der konkreten Anwendung orientiert. Der EU AI Act schreibt keine Formate vor, sondern überlässt es den Unternehmen, passende Qualifizierungswege zu gestalten – Hauptsache, sie sind nachvollziehbar und wirksam dokumentiert. Ob E-Learning, Workshops, Coachings oder Communities: Wichtig ist, dass Inhalte rollenbasiert vermittelt und in reale Anwendungskontexte eingebettet werden.
Welche Rolle spielen Zielgruppen, Vorkenntnisse und Anwendungskontexte bei der Auswahl geeigneter Schulungsformate?
Ein Entwickler braucht anderes Wissen als ein Vertriebsmitarbeiter oder jemand aus dem Compliance-Team. Deshalb müssen Trainingsangebote differenziert nach Zielgruppen und Einsatzszenarien gestaltet sein. Je stärker eine Rolle in die Entwicklung oder Nutzung von KI eingebunden ist, desto tiefer sollte das Verständnis für Risiken, Funktionsweise und regulatorische Anforderungen reichen.“
In welchen Fällen kann ein Zertifikat sinnvoll sein – und wann reicht ein internes Training aus?
Ein Zertifikat kann dann sinnvoll sein, wenn Unternehmen mit Hochrisiko-KI arbeiten und regulatorische Nachweise erforderlich sind – etwa im Gesundheits- oder Finanzbereich. In vielen Fällen genügt jedoch ein dokumentiertes internes Training. Entscheidend ist nicht die Form des Nachweises, sondern dass Kompetenzaufbau und Risikoumgang glaubhaft belegt werden können.
Wie lassen sich Trainingsangebote sinnvoll strukturieren – etwa als Basic-, Rollen- oder Expertentraining?
Ein mehrstufiges Modell hat sich bewährt: Ein breites Basistraining schafft ein gemeinsames Verständnis, rollenbasierte Vertiefungen machen spezifisches Wissen zugänglich und Expertentrainings adressieren Schlüsselrollen wie Entwickler oder Risikoanalysten. So entsteht ein skalierbares Trainingskonzept, das sich mit der zunehmenden KI-Reife im Unternehmen weiterentwickeln kann.